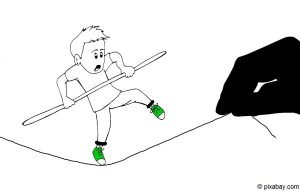Die Postmoderne hat die schrankenlose Selbstbestimmung des Menschen zum obersten Prinzip erhoben. Die Gratwanderung der absoluten Freiheit erweist sich jedoch zunehmend als tödlicher Irrweg für unsere freie Gesellschaft. Im Schatten eines grenzenlosen Liberalismus werden immer mehr Menschen zu Opfern eines egoistisch-individualistischen Lebensstils. Unveräusserliche Menschenrechte werden zu Spielbällen freiheitsfeindlicher Ideologien. Wo liegen Fundament und Grenze echter Freiheit?
Von Dominik Lusser
Gerade bei Kernthemen des Menschseins wie Familie, Sexualität oder Lebensrecht werden individuelle Handlungsspielräume gesetzlich ständig ausgeweitet. Da wird etwa gefordert, das „Gefängnis“ Ehe abzuschaffen: Denn der Staat habe dem Volk ja schliesslich nicht vorzuschreiben, wie es zu leben habe. Andere setzen sich im Namen von Forschungsfreiheit und konkurrenzfähiger Wirtschaft für einen immer hemmungsloseren Umgang mit Embryonen ein: Denn was man könne, das dürfe man auch. Andrea Büchler, Präsidentin der Nationalen Ethikkommission, plädiert sogar für die Zulassung der Leihmutterschaft, um auch schwulen Paaren mehr Spielraum für die individuelle „Familien“-Planung zu bieten. Dem hedonistisch-individualistischen Zeitgeist entsprechend übertrumpft man sich gegenseitig mit ultra-liberalen Forderungen.
Was ist heute ethisch?
Die dominierende Ethik unserer postmodern entgrenzten Gesellschaft lautet: Jeder moralische Standpunkt, auch dein eigener, ist nur relativ. Die Grenzen eines ständig liberaleren Strafrechts auszuloten gilt als Recht, ja als Kennzeichen einer liberalen Gesellschaft. Was heute für straffrei erklärt wird, gehört morgen zum guten Ton und wird übermorgen zum „Menschenrecht“. Wer diese Entwicklung infrage stellt und unverhandelbare Werte vertritt, gilt schnell als Moralist und antiliberal. Als „Pädagogik der Vielfalt“ oder Demokratie-Erziehung (wobei hier offensichtlich ein Missverständnis über das Wesen der Demokratie als Staatsform vorliegt) wird diese radikal relativistische Grundhaltung bereits in der Volksschule im Denken der Schüler verankert.
Schrankenlose Freiheit hat das Potential, in ihr Gegenteil zu kippen. Wenn es heute in der Schweiz fast schon ethische Pflicht ist – vielleicht bald schon gesetzliche Vorschrift für Ärzte – einem jeden Lebensmüden beim Freitod behilflich zu sein, ist der Wendepunkt längst überschritten. Auch wenn es aus Mitleid geschieht, stellt ein Staat, der die Tötung zum Recht oder zur Pflicht erklärt, das Leben als grundlegendstes Rechtsgut und somit sein Fundament als freiheitlicher Rechtsstaat infrage. Erinnern wir uns: Die Freiheit auf gesellschaftlicher Ebene beginnt da, wo ein jeder das Leben des anderen als unantastbar respektiert. Wo nach einem alten Sprichwort „der Mensch dem Menschen ein Wolf ist“, gibt es weder Rechtssicherheit noch freie Entfaltung. Überhaupt ist es mehr als fragwürdig, den Selbstmord als sinnvollen Gebrauch der eigenen Freiheit zu sehen. Denn was soll denn das für eine Freiheit sein, die das Subjekt ebendieser Freiheit vernichtet?
Absolute Selbstbestimmung?
Das Prinzip, wonach der eigene Freiheitsraum durch die Freiheit anderer begrenzt wird, und im Konfliktfall die Verhandlungsmoral zum Zug kommt, ist zwar wichtig. Es genügt aber bei weitem nicht, um die Freiheit aller zu schützen. Denn zum einen gibt es Personen, die noch nicht oder nicht mehr verhandlungsfähig sind. Durch den Skandal der Abtreibung werden täglich ungeborene Kinder der rücksichtslosen „Freiheit“ anderer geopfert. Auch die teuren alten Menschen, deren Freiheitsraum schon deutlich eingeschränkt ist, sind potentielle Opfer einer ultra-„liberalen“ Kultur, die aus Mitleid sogar tötet. Ferner gibt es auch die Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die aufgrund ihres Entwicklungsstandes zu unreifem oder gar selbstgefährdendem Verhalten neigen. Auch sie dürfen nicht einfach ihrer Selbstbestimmung und einer Verhandlungsmoral ohne übergeordnete Werte überlassen werden. Denn sie sind erst dabei zu lernen, wie man mit seiner Freiheit richtig umgeht.
Was aber ist dann das Fundament bzw. die Grenze der Freiheit? Der Aufklärungsphilosoph Immanuel Kant formulierte ein wichtiges moralisches Prinzip (einen „kategorischen Imperativ“), wonach die menschliche Person niemals bloss als Mittel zum Zweck gebraucht werden darf, sondern ihrer Würde entsprechend immer Ziel des Handelns sein muss. Den Menschen entsprechend seiner Würde zu behandeln aber bedeutet nach Auskunft uralter abendländischer Tradition nichts anderes als den Menschen seiner Natur entsprechend zu behandeln. Noch bevor die griechischen Philosophen und römischen Juristen die theoretischen Grundlagen des europäischen Naturrechts legten, fand diese zentrale menschliche Einsicht mit den „Zehn Geboten“ bereits ihren Niederschlag in der jüdisch-christlichen Offenbarung. Diese Gebote bringen in negativer Formulierung („Du sollst nicht…“) zum Ausdruck, was ein jeder Mensch braucht, um sein Menschsein zu entfalten, und was ihm folglich von anderen nicht vorenthalten werden darf: Solidarität im Alter, das Recht auf Leben, gesunde Scham zum Schutz der Intimität, Wahrheit und Bildung, Ehe und Familie, Eigentum zur Existenzsicherung.
„Ökologie des Menschen“
Mit Papst Benedikt XVI. müssen wir heute von einer dringend notwendigen „Ökologie des Menschen“ sprechen. Denn die Art Mensch bedroht sich selbst, indem sie im Namen eines Pseudoliberalismus etwa ihre Identität als Mann und Frau verleugnet oder immer weiteren Personengruppen (wie z.B. Trägern gewisser Erbkrankheiten) die Zugehörigkeit zur Art Mensch und die damit verbundenen unveräusserlichen Rechte streitig macht.
Es ist heute dringender denn je, die Natur des Menschen wieder in ihre Stellung als Quelle von Recht und Moral einzusetzen. Es geht hier nicht um Traditionalismus, sondern um die Erneuerung lebensnotwendiger Einsichten, die heute nach und nach aus dem Blickwinkel zu geraten scheinen. Dabei haben die modernen Natur- und Humanwissenschaften das Wissen über den Menschen in den letzten Jahrzehnten auf eindrückliche Art und Weise verfeinert und vermehrt: Angefangen vom Zeitpunkt der Entstehung eines neuen menschlichen Individuums über die emotionalen Bedürfnisse von Kindern bis hin zu den Unterschieden zwischen den Geschlechtern und ihren komplexen Ursachen; was wir heute über den Menschen wissen, ist phänomenal. Es liegt an uns, diese Einsichten nicht bloss in technische Machbarkeit umzumünzen, sondern daran auch unsere ethische Kompetenz, d.h. den Gebrauch unserer Freiheit wachsen zu lassen.
Natur als normative Kraft
Die rechtstheoretische Diskussion begann sich zwar schon vor dem zweiten Weltkrieg vom Naturrecht loszulösen, und sich mehrheitlich einem immer absoluteren Rechtspositivismus zuzuwenden („Unrecht ist, was bestraft wird“: ein Unsinn, der gerade während der Nazizeit auf besonders tragische Art widerlegt wurde). Doch basieren immer noch weite Teile unserer historisch gewachsenen Rechtsordnung auf einer fundierten Einsicht in natürliche Zusammenhänge. Bis in die jüngste Vergangenheit finden sich jedenfalls selbst in Stellungsnahmen des Schweizer Bundesrats eindeutig naturrechtliche Argumente. Im Vorfeld der Abstimmung zum Partnerschaftsgesetz am 5. Juni 2005 hielt dieser noch treffend fest: „Von der Natur vorgegeben ist, dass jedes Kind einen Vater und eine Mutter hat, die für die Entwicklung des Kindes ihre spezifische Bedeutung haben. Das Kindesrecht des Zivilgesetzbuches (…) versucht dementsprechend, jedem Kind auch rechtlich, einen Vater und eine Mutter zuzuordnen und damit der Polarität der Geschlechter Rechnung zu tragen.“
Zwar sind die theoretischen Argumente gegen das Naturrecht – das als naturalistischer Fehlschluss oder Biologismus verschrien ist – mittlerweile zahlreich. Das aber spricht nicht gegen die Tragfähigkeit der Naturrechtsethik im alltäglichen Leben. Dem gesunden Menschenverstand leuchtet der moralische Imperativ der Natur immer noch mehr ein als die Macht des Faktischen. Denn nicht alles, was vorkommt, ist auch gut! Allerdings droht, bei genügender Wiederholung des Gegenteils, auch das Offensichtlichste in seiner Klarheit zu verblassen. Manche Mitglieder des Bundesrats befürworten heute – gerade mal elf Jahre nach dem Partnerschaftsgesetz – sogar die „Ehe für alle“, mit der auch das Recht für gleichgeschlechtliche Paare verbunden wäre, Kinder zu adoptieren.
Was aber bedeutet es für die menschliche Freiheit, wenn immer mehr fundamentale Lebensvollzüge und Lebenszusammenhänge „entnaturalisiert“ werden? Was auf den ersten Blick als Emanzipation und Befreiung erscheint, kehrt sich nur allzu schnell in sein Gegenteil! Denn was sonst sollte den Menschen vor Willkür (auch seiner eigenen Willkür) schützen können, wenn nicht seine unveräusserliche Würde, die ihm aufgrund seiner menschlichen Natur zukommt?
Unveräusserliche Menschenrechte?
Als spanische Dominikanermönche im 16. Jahrhundert als erste Menschenrechte formulierten, hielten sie fest, dass auch den Indios als Träger derselben menschlichen Vernunft-Natur die gleichen unveräusserlichen Freiheitsrechte wie den Europäern zukommen sollten. Von dieser naturrechtlichen Ausrichtung zeugen bis heute die grossen Menschenrechtserklärungen der UNO und des Europarats. Und ebenso – wenn allerdings auch nur noch teilweise – deren Auslegung durch die Gerichte. Die UN-Erklärung über die Rechte des Kindes (1989) formuliert z.B. mit dem Recht jedes Kindes, „seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden“ (Art. 7, 1), einen Grundsatz, der jede Form der Homo-„Elternschaft“ prinzipiell ausschliesst. Und ein im Sommer 2016 gefälltes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bestätigt erneut, dass sich homosexuelle Paare nicht auf das Menschenrecht auf Ehe und Familiengründung berufen können; dass dieses unveräusserliche Recht also die natürliche Bipolarität der Geschlechter zur notwendigen Voraussetzung hat.
Doch die Schlacht um die Entwertung der Natur als Grundlage des menschlichen Miteinanders tobt weltweit gewaltig. Die Führungen von UNO und EU haben sich – ihrer Propaganda für globale Nachhaltigkeit zum Trotz – mit der Unterstützung der Gender-Ideologie klar bei den Gegnern der Naturordnung eingereiht. Was auf dem Spiel steht, ist klar: Mit der Leugnung einer objektiv erkennbaren Natur fallen die unveräusserlichen Rechte des Menschen, und letztlich auch die Freiheit. Die Menschenrechte werden zu leeren Worthülsen, die mit ständig wechselnden ideologischen Inhalten gefüllt werden könnten. Wie dies bereits heute geschieht, zeigt der Slogan der feministischen Abreibungslobby: „Mein Bauch gehört mir“; oder die militante Forderung von LGBT-Verbänden, sogenannte Regenbogen-„Familien“ in jeder Hinsicht und um jeden Preis (z.B. durch die Ausbeutung von Frauen durch Leihmutterschaft) der natürlichen Familie gleichzustellen.
Was in Zukunft droht, ist die Verschärfung eines durch Partikularinteressen geleiteten Machtkampfs um die Deutungshoheit von „Menschenrechten“, die in ihrer Bedeutungsleere dann niemanden mehr schützen können. Der Manipulierbarkeit des Menschen durch Juristen oder demokratische Mehrheiten wären dann Tür und Tor geöffnet.
Das Ende des freien Menschen?
Die Natur als Massstab ethischer Entscheidungen wurde in Europa zuerst durch den englischen Empiristen David Hume im 18. Jahrhundert prinzipiell abgelehnt. Ausgehend von einem reduktionistischen, rein mechanischen Naturverständnis (das das Verdrängen alter Bäume durch einen neuen Spross mit dem Elternmord gleichsetzte), beseitigte Hume die vernünftige Naturerkenntnis als Quelle der Moral. Diese sollte künftig auf einem durch Erziehung und Gewöhnung erworbenen „moralischen Gefühl“ begründet werden. Nach Hume entscheidet – etwas vereinfacht gesagt – der Verstand über die Nützlichkeit, das Gefühl aber über die moralisch gute Handlung. Heute scheint ein Emotivismus Humescher Prägung zur meist verbreiteten moralischen Haltung geworden zu sein. Und dies verschärft das Problem der bedrohten Freiheit nur noch mehr. Emotionen wie Mitgefühl sind zwar für moralisches Handeln wichtig. Als alleiniger Massstab sind sie aber wegen ihrer Unstetigkeit und Manipulierbarkeit letztlich ungenügend.
Symptomatisch hierfür ist der gegenwärtige Erfolg der LGBT-Propaganda: Sachlich spricht nichts für die Einführung einer „Ehe für alle“. Stattdessen werden homosexuell empfindende Menschen ständig als Opfer einer vermeintlich diskriminierenden Gesellschaft inszeniert. Und dies mit Erfolg! Wer sich in unserer Gesellschaft gegen die Homo-„Ehe“ ausspricht, hat nicht einfach eine andere Meinung. Vielmehr gilt er vielen als homophob, ja als gefühlsloser Unmensch, der anderen das Glück vorenthält. Jedenfalls wird er zumindest in den Medien so dargestellt.
Humes skeptizistischer Kurzschluss: „Aus dem Sein folgt kein Sollen“, hat im postmodernen Konstruktivismus einen mächtigen Verbündeten gefunden: Der Mensch habe gar keine erkennbare Natur, lautet die dominierende Ansicht bei den Human- und Sozialwissenschaftlern an unseren Universitäten. Vielmehr sei er ein ständig veränderbares Konstrukt seines sozialen Umfeldes, ein Produkt der Machtverhältnisse, die ihn durchwirkten. Das Schicksal des Menschen liegt so in den Händen einer willkürlichen Gewalt, Diskurshoheit genannt, um die in Politik, Medien, Schulen und Universitäten gebuhlt wird. Diese neue, unseren Zeitgeist immer mehr durchdringende Sicht auf den Menschen verwandelt die Frage, was eigentlich der Mensch sei, von einer Frage vernünftiger Erkenntnis in einen Machtkampf. Wo aber Wissen nurmehr „machthaltiger Zugriff auf die Welt“ (Michel Foucault) sein soll, ist ein vernunftgeleiteter Gebrauch der Freiheit nicht mehr möglich.
Die Postmoderne hat die Welt der Menschen in eine gigantische Echokammer verwandelt, wo es nicht mehr um Fakten und Wahrheit geht, sondern alles für relativ erklärt wird. So beliebig und willkürlich wie die Selbstbestimmung des einzelnen Menschen, ist in der Postmoderne aber auch die Ausübung politischer Macht. Diese, und nicht mehr die dem Menschen eigene Natur, bestimmt fortan dem Individuum den Radius seines freien Handelns.
Der scheinbar völlig befreite, postmoderne Mensch taumelt so in seiner Orientierungslosigkeit zwischen absoluter Selbstbestimmung und totaler Manipulation. Wer seine eigene Natur als Kompass aus den Augen verliert, läuft Gefahr auch seine Freiheit zu verlieren.