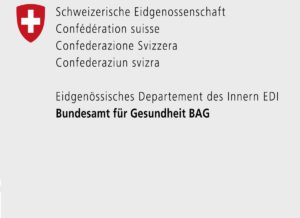Weil Minderjährige heute ohnehin stark sexualisierten Einflüssen im öffentlichen Raum ausgesetzt sind, dürfen auch Behörden in Informationskampagnen Kindern und Jugendlichen alles zumuten, was nicht unter Pornografie im strafrechtlichen Sinn fällt. So lautet die fragwürdige Logik des Urteils des Bundesgerichts zur umstrittenen HIV-Präventionskampagne „Love Life – bereue nichts“ des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Politische Interessen dürften dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben.
Von Dominik Lusser
Das Bundesgericht bestätigt mit seinem Urteil vom 15. Juni 2018 die Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 2016, wonach durch das Bildmaterial der BAG-Kampagne von 2014 die schutzwürdigen Interessen von Kindern und Jugendlichen (Art. 11 BV) nicht verletzen würden. Das BAG sei folglich auf das Gesuch von 35 Minderjährigen und ihren gesetzlichen Vertretern, die Kampagne zu stoppen, zu Recht nicht eingetreten.
Die entscheidende Frage ist laut dem Bundesgericht, ob Kinder und Jugendliche durch die Kampagne spürbar anderen und stärkeren sexualisierenden Einflüssen ausgesetzt worden seien, als dies heute z.B. durch die Werbung ohnehin der Fall sei. Das Gericht misst damit das behördliche Handeln an der Macht des Faktischen, das der Öffentlichkeit durch die Filmindustrie und die Werbebranche diktiert wird.
Strafrecht als Massstab?
Folgt man der Logik des Bundesgerichts, dürfen Behörden in ihrem Handeln Minderjährigen alles zumuten, was nicht Pornografie im Sinne des Strafrechts ist. Dabei zeigt ein von den Beschwerdeführern vorgelegtes wissenschaftliches Gutachten, dass sich auch sexualisierte Bilder, die nicht als Pornografie eingestuft werden, negativ auf die psychische Entwicklung insbesondere von Mädchen auswirken können.
Die Psychologin Tabea Freitag und der Sexualforscher Dr. Jakob Pastötter, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Sexualforschung, stellen fest: „Selbst wenn solche Medieninhalte nur auf die Geschlechtlichkeit reduziert und nicht auf die erregten Genitalien fokussiert sind, haben sie bei Kindern und Jugendlichen tiefgreifende Folgen für die Entwicklung einer selbstständigen Sexualität und auch einer stabilen Persönlichkeit. Dieses Ergebnis hat insbesondere eine umfangreiche Metastudie der American Psychological Association (APA) 2007 aufzeigen können. Es erscheint kaum nachvollziehbar, dass das Schweizer Bundesamt für Gesundheit eine Kampagne lanciert hat, in der besonders der Einführungsclip und auch einzelne Plakate als sexualisierend zu beurteilen sind.“
Dass das Bundesgericht das Gutachten zur Wirkung der Love Life-Kampagne als „unzulässiges echtes Novum“ wertete und als Beweismittel nicht zuliess, ändert nichts an der Tatsache, dass das oberste Schweizer Gericht mit seiner Einschätzung, vor welcher Art Bildmaterial Kinder zu schützen seien, der entwicklungspsychologischen und sexualwissenschaftlichen Forschung keine Rechnung trägt.
Wie das Bundesgericht zur Einschätzung gelangen konnte, im Video-Clip der Kampagne, das Paare in schnell geschnittenen Sequenzen beim Sex zeigt, würden keine „sexuell aufgeladenen Botschaften dargestellt“, ist aus Sicht der Experten ebenfalls nicht nachvollziehbar: „Das Argument, durch die Kürze der gezeigten Szenen werde keine Wirkung auf kindliche und jugendliche Betrachter erzielt, ist nicht stichhaltig.“ Die Mediennutzung in dieser Altersgruppe zeichne sich nämlich gerade dadurch aus, extrem schnelle Wechsel und Schnittfolgen im rasanten Clip-Stil zu erwarten. Diese Technik werde auch in Werbung und in der Pornografie verwendet, weil solche Schnitttechniken und Erzählmuster noch intensivere Erregung auslösen können als der im Vergleich dazu langsame Aufbau einer komplexen Geschichte, halten Freitag und Pastötter fest. „Viele Konsumenten von Pornografie berichten in Selbsthilfegruppen, dass sie oft sogar mehrere Clips gleichzeitig in verschiedenen Fenstern laufen lassen, um zwischen ihnen hin und her zu wechseln, und so ihre Erregung steigern.“
Die Kampagne hatte, wie Freitag und Pastötter ferner zu bedenken geben, das Ziel, zum Schutz vor Geschlechtskrankheiten aufzufordern. „Davon abweichend musste sie allerdings verstanden werden als Aufforderung zu einer rein lustbetonten Sexualität.“ In Bezug auf Kinder und Jugendliche müsse deshalb gefragt werden, „ob die Kampagne nicht Probleme geschaffen hat, vor denen sie warnen wollte!“
Pornografische Standards
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Darstellungen, die ihrer Entwicklung schaden können, ist damit nicht einmal mehr im behördlichen Handeln garantiert. Es ist äusserst bedauerlich, dass das Bundesgericht mit dem vorliegenden Entscheid dem BAG quasi einen Freibrief ausstellt, die Grenzen des Sexualstrafrechts auszuloten.
Auch wenn das BAG seit 2014 – wohl eingeschüchtert durch das laufende Verfahren – auf explizite Bilder verzichtet hat, stellt die Kampagne 2018 ein weiterer Tiefpunkt der Entwicklung dar. Einer der neuen Clips zeigt eine Frau, die sich niederkniet und lustvoll durch einen Schlauch ein Aquarium aussaugt. Abgesehen davon, dass diese bewusst zweideutige Szene von vielen Frauen und auch schon von Teenagerinnen als Erniedrigung empfunden werden dürfte (während Kinder gar nicht verstehen, worum es geht), etabliert dieser Clip eine pornografische Standardpraktik, welche die meisten Frauen als eklig empfinden, als sexuelle Normalität.
Laut der Mediensucht-Therapeutin Tabea Freitag fragen sich aber nicht wenige Mädchen und Jungen, ob sie entgegen eigenem Wunsch Oral- oder Analverkehr mitmachen müssen, von denen sie glauben, das gehöre zum Standard. Nach einer Untersuchung von Kolbein (2007) haben 80 Prozent der 14- bis 18-jährigen Jugendlichen zwar in Pornos Oralverkehr gesehen. Aber nur 2,3 geben an, diese Praxis auch zu mögen. Laut derselben Studie haben 61 Prozent Analverkehr gesehen, bei einer Präferenz von nur 1,5 Prozent. In der Arbeit mit Mädchen und Frauen zeigt sich laut Freitag, dass die Grenze zu sexuellen Übergriffen teilweise fliessend ist, wenn der Druck des Freundes, durch Pornos inspirierte Praktiken mitzumachen, durch Abwertung („frigide/ verklemmt/ Langweiler“) oder Erpressung („dann muss ich‘s mir eben woanders holen“ oder „dann trenn ich mich“) bis hin zu Cybermobbing verstärkt wird.
Dass Jugendliche auch in der Schweiz sexuelle Übergriffe mehrheitlich durch Gleichaltrige erleiden (Optimus-Studie 2012), hätte dem BAG also zu denken geben müssen. Doch die oberste Gesundheitsbehörde scheint ganz offensichtlich gar nicht darum bemüht zu sein, die Wirkung seiner Kampagnen auf die Bevölkerung und insbesondere Minderjährige auf Risiken zu prüfen oder aus Fehlern vorangegangener Kampagnen zu lernen.
Ein politischer Entscheid
Dass die kolossale fachliche Inkompetenz, die das BAG schon mit der Kampagne 2014 unter Beweis stellte, vom Bundesgericht unbescholten blieb, legt den Verdacht eines primär politisch motivierten Entscheides nahe.
Hätte nämlich das oberste Gericht zu Ungunsten des BAG entschieden, wäre nicht nur die oberste Gesundheitsbehörde in einem schlechten Licht dagestanden, sondern auch deren für die Kampagne mitverantwortlichen Partnerorganisationen „Sexuelle Gesundheit Schweiz“ (SGS) und „Aids-Hilfe Schweiz“. Hätte das Bundesgericht die Kampagnen-Führer wegen ihres fahrlässigen Umgangs mit den schutzwürdigen Interessen Minderjähriger gerügt, hätte dies den gesellschaftlichen Druck insbesondere auf den Bundespartner SGS zusätzlich erhöht. Politische Konsequenzen für die hochumstrittene Sexualpädagogik-„Quasimonopolistin“ wären wohl unausweichlich geworden.
Blenden wir von der Justiz in die Politik: Nationalrat Fabio Regazzi hatte ausgehend von der Love Life-Kampagne 2014 in einem Postulat (14.4115) eine wissenschaftliche Untersuchung der theoretischen Grundlagen zur sexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefordert, auf denen SGS ihre Arbeit aufbaut. Diese Grundlagen seien nämlich, so Regazzi, „unter Experten sehr umstritten“. Die Untersuchung sollte durch eine „insbesondere von SGS unabhängige Expertenkommission“ aus Vertretern verschiedener relevanter Disziplinen erfolgen.
Im Februar 2018 präsentierte der Bundesrat seinen Postulatsbericht, der gestützt auf einen gleichzeitig veröffentlichten Expertenbericht festhält: „Die Expertengruppe unterstreicht, dass die Love Life-Kampagne gesellschaftlich anerkannte Werte vermittelt, wie Nicht-Diskriminierung und Respektierung von Unterschieden. Die Kampagne leistet gemäss Einschätzung der Experten somit einen Beitrag zur Entwicklung eines respekt- und verantwortungsvollen Verhaltens.“
Wie die vom BAG eingesetzten Experten zu dieser Einschätzung der Love Life-Kampagne gelangen konnten, ist aus ihrem Bericht nicht nachvollziehbar. Nichts deutet darauf hin, dass die Frage nach der Wirkung sexualisierter Bilder aufgrund von Forschungsliteratur beantwortet worden wäre. Auch wurde die von Regazzi aufgeworfene Frage nicht beantwortet, ob der „Ekel“, den die Love Life-Kampagne bei Kindern auslösen kann, tatsächlich als pädagogische „Chance“ zu sehen ist, wie SGS behauptet.
Der vom Bundesrat präsentierte „Freispruch“ für „Love Life“ hat noch weitere Schwachstellen. So unterschlug die Regierung in ihrem Postulatsbericht, dass gemäss Expertenbericht (vgl. S. 96) selbst Fachleute, die grundsätzlich SGS-freundlich eingestellt sind, Kritik an den Love Life-Kampagnen geltend gemacht hatten. Es wurde beispielsweise bemängelt, „dass die Botschaften der Kampagne nicht immer selbsterklärend und gelegentlich betreffend Darstellung von Sexualität zu explizit seien“.
Bundesgericht hin oder her
Man kommt nicht umhin, den Entscheid des Bundesgerichts auch als Bestätigung dieses dubiosen Expertenberichts zu sehen. Hätte das Bundesgericht nämlich gegen das BAG entschieden, wäre nicht zuletzt auch der Bundesrat selbst in arge Erklärungsnot geraten. Dieser hat mit dem vorgelegten Expertenbericht seine Entschlossenheit deutlich gemacht, sein Festhalten an SGS als Bundespartner selbst gegen wissenschaftliche Evidenz durchzusetzen.
Doch der Druck auf den Bundesrat, das BAG und SGS hält weiter an. Die Stiftung Zukunft CH wird noch im Juli 2018 der Öffentlichkeit eine umfangreiche Analyse des 176 Seiten umfassenden Expertenberichts präsentieren. Diese soll nicht nur die fehlende Wissenschaftlichkeit, sondern auch die mangelnde Unabhängigkeit des Expertenberichts schonungslos aufzeigen.
Eine gesellschaftlich breit abgestützte und wissenschaftlich seriöse Auseinandersetzung mit der jugendgefährdenden Love Life-Kampagne hat damit – Bundesgericht hin oder her – möglicherweise erst begonnen. Vorausgesetzt natürlich, dass der politische Wille dazu aufgebracht werden kann.